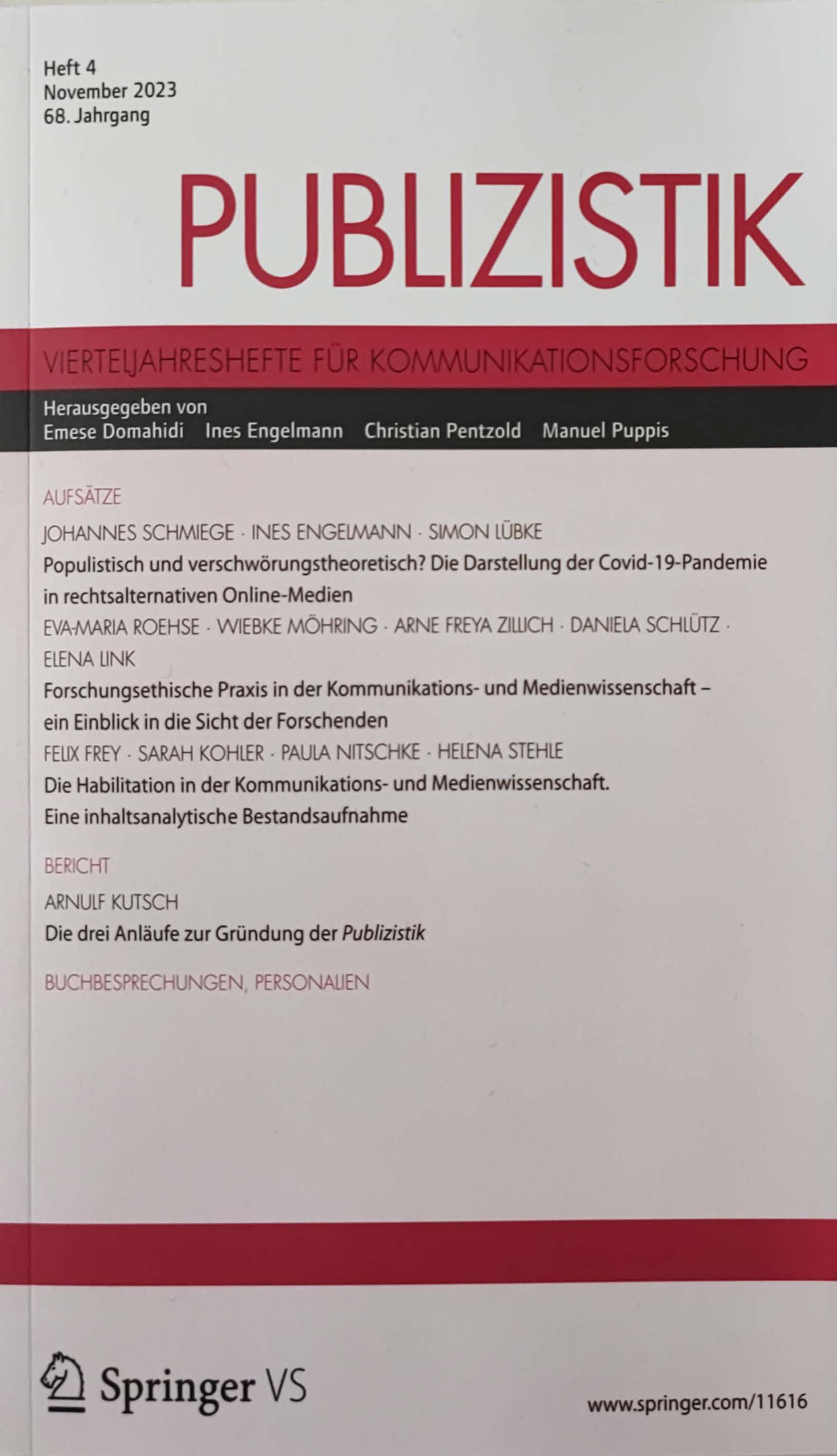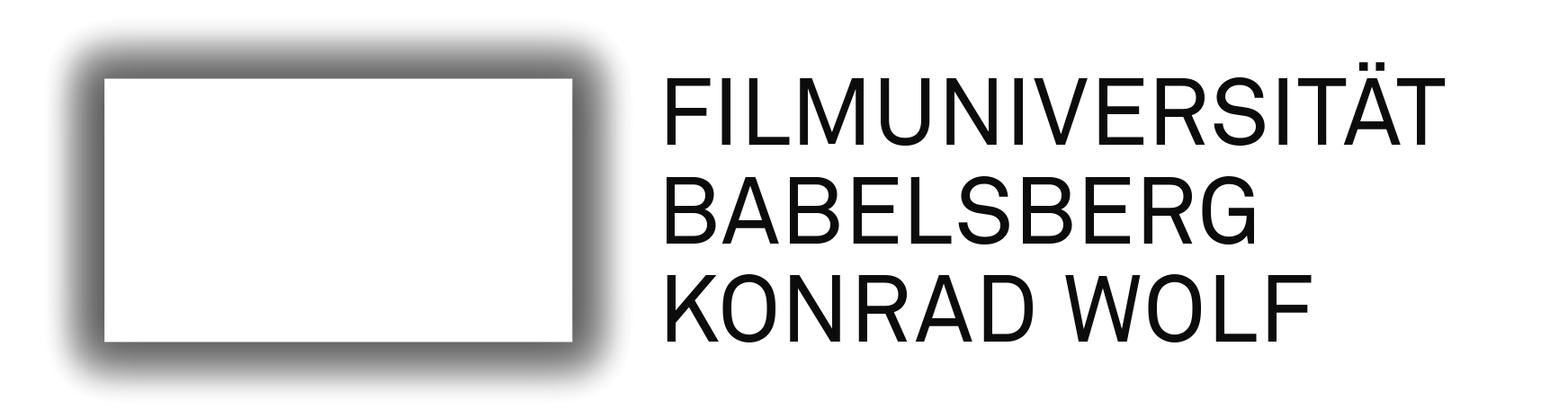Das Projekt FeKoM
Zur Navigation auf dieser Website
-
Reiter Über das Projekt: Informationen zur Projektskizze und zum Team
-
Reiter Forschungsergebnisse: Ergebnisse der FeKoM-Studien, Übersicht Forschungsdatenmanagement, Landkarte Ethikkommissionen, Übersicht FeKoM-Publikationen
-
Reiter Best Practice: Handreichungen für die eigene Forschung und Lehrmaterialien aus dem FeKoM-Projekt und aus anderen Projekten/Themengebieten
-
Reiter Literatur: Literatursammlung zum Thema Forschungsethik mit eigener Suchfunktion
-
Reiter Links: Linksammlung zum Thema Forschungsethik z. B. zu Leitlinien oder Lehrmaterialien
-
Reiter Archiv: ehemals "Aktuelles", Texte zu Ereignissen aus dem FeKoM-Projekt, Publikationshinweise
Das Projekt wurde Ende Februar 2024 erfolgreich abgeschlossen. In diesem Zuge wurden auch das Forum und die Login-Funktion eingestellt.
Forschungsethik – also der respektvolle und wertschätzende Umgang mit allen an empirischen Forschungsprojekten beteiligten Personen – ist ein wesentlicher Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis. Forschungsethik bezieht sich auf gesetzliche Bestimmungen (etwa Wissenschaftsfreiheit oder informationelle Selbstbestimmung), berücksichtigt ethische Aspekte sowie wissenschaftliche Forschungsmethodik.
 Powered by WordArt.com
Powered by WordArt.com
In der Kommunikations- und Medienwissenschaft (KMW) gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Ein Grund dafür ist, dass die Forschungsgegenstände der KMW (z. B. digitale öffentliche Kommunikation) ebenso wie ihre Forschungsmethoden einem stetigen Wandel unterworfen sind und zunehmend komplexer werden. Dadurch entstehen neue (forschungs)ethische Herausforderungen. Zudem legt das Wissenschaftssystem zunehmenden Wert auf ethische Reflexion, etwa bei Drittmittelanträgen oder in wissenschaftlichen Publikationen.
Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des vom BMBF geförderten Verbundprojektes FeKoM, evidenzbasierte, also theoretisch und empirisch fundierte Empfehlungen für eine angewandte Forschungsethik in der quantitativ forschenden KMW zu formulieren. Diese wurden der Scientific Community zur Verfügung gestellt und für die Vermittlung in der Lehre aufbereitet.