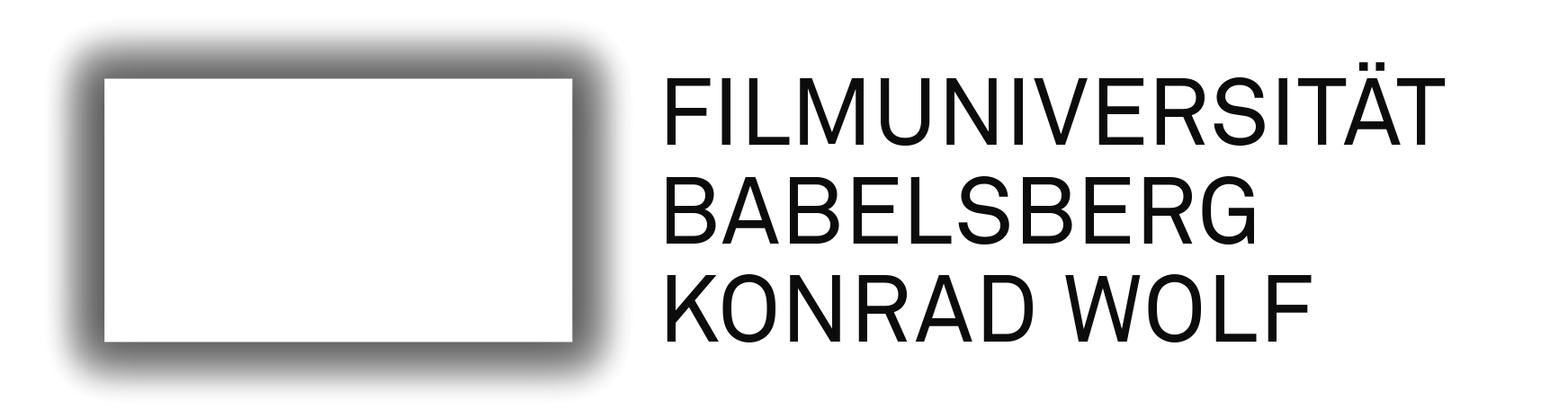Handreichungen und Empfehlungen
Aus dem FeKoM-Projekt
Im Rahmen des FeKoM-Projektes wurden verschiedene Handreichungen und praxisorientierte Checklisten für eine prozessorientierte Vorgehensweise entwickelt, die hier zur Verfügung stehen.
Unter "Praktische Empfehlungen" finden sich forschungspraktische Handreichungen, die Sie bei der Umsetzung eigener Forschungsvorhaben unterstützen können. Unsere selbst erstellten Materialien umfassen eine Checkliste zum Thema Datenschutz, eine Vorlage zu Studien- und Datenschutzinformationen inklusive einer dazugehörigen Checkliste zur Anwendung sowie eine Checkliste zur forschungsethischen Selbstreflexion.
Unter "Lehre und Vermittlung" finden Sie aus dem FeKoM-Projekt stammende Lehrmaterialien, die Sie in Ihre eigenen Lehrveranstaltungen integrieren können. Dazu haben wir ein Lehrvideo und zwei Handouts entwickelt.
Praktische Empfehlungen
Checkliste Datenschutz
Ein zentraler Baustein im Kontext von forschungsethischen Überlegungen sind Informed-Consent-Prozeduren. Doch welche datenschutzrechtlichen Fragen stellen sich, wenn z.B. für eine Online-Befragung eine Studien- und Datenschutzerklärung aufgesetzt werden soll, zu der die Teilnehmenden (im besten Fall) auch zustimmen? Das Team des FeKoM-Projektes hat in Zusammenarbeit mit einem für den Datenschutz zuständigen Mitarbeiter der TU Dortmund eine Checkliste entwickelt, die Forschenden bei diesem Schritt in ihren Projekten unterstützen kann. Ein PDF-Dokument der Checkliste als Download gibt es hier.
Stand: 15.03.2023
Checkliste
|
Nummer |
Frage und Erläuterung |
|
1 |
Wer ist der*die "Verantwortliche" im Datenschutz nach Art. 4 Abs. 7 DSGVO? Also welche Person/Institution entscheidet über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der (personenbezogenen) Daten? Anmerkung: Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. |
|
2 |
Gibt es an meiner Institution eine*n Datenschutzbeauftragte*n, der* die in der Datenschutzerklärung auch genannt werden kann? |
|
3 |
Ist benannt, zu welchen Zwecken die Daten verarbeitet werden sollen? |
|
4 |
Ist die Rechtsgrundlage, auf der die Daten verarbeitet werden, benannt? Eine Auflistung der Rechtsgrundlagen der Datenschutzgrundverordnung und Erläuterungen findet sich hier: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data_de Neben den Rechtsgrundlagen der DSGVO können weitere Rechtsgrundlagen (z.B. in den Datenschutzgesetzen der Länder) in Betracht kommen. |
|
5 |
Welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? |
|
6 |
Werden personenbezogener Daten, aus denen sensible Informationen, wie die politische Meinung, die religiöse oder weltanschauliche Überzeugung hervorgehen, verarbeitet? Werden genetische Daten oder biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung der Teilnehmenden, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung verarbeitet? In diesem Fall benötigen Sie eine besondere Rechtsgrundlage (z.B. Art. 9 DSGVO). |
|
7 |
Wer bekommt neben den "Verantwortlichen" der Studie ebenfalls die (personenbezogenen) Daten? Werden die Empfänger*innen der Daten aufgezählt? |
|
8 |
Werden Dienstleister genutzt, die auf die (personenbezogenen) Daten zugreifen können (z.B. Transkriptionsdienste, Software-Anbieter)? Werden die Dienstleister benannt und besteht eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten? |
|
9 |
Werden die personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union oder dem Europäischem Wirtschaftsraum verarbeitet und besteht eine rechtliche Legitimation, die Daten in diese Länder zu übermitteln? Dies gilt sowohl für die "Verantwortlichen" als auch für die "Dienstleister". Eine Auflistung der Länder der EU/ des EWR finden sich hier: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/02-ewr-eu/606444 |
|
10 |
Wie lange und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten gespeichert? |
|
11 |
Wird auf die einschlägigen Rechte der betroffenen Personen hingewiesen (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Widerruf einer Einwilligung, Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde)? |
|
12 |
Stammen die Daten noch aus weiteren Quellen als der Direkterhebung (Erhebung der Daten bei der Person selbst)? Ist diese weiter Quelle benannt? Weitere Informationen dazu finden sich hier: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_10.pdf |
|
13 |
Sollen die Daten noch zu einem anderen Zweck als der eigentlichen Studie verwendet werden und ist dieser Zweck benannt und hinreichend konkretisiert? Weiter Informationen finden sich hier(„Zweckänderung“): https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_10.pdf |
|
14 |
Besteht eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling auf Basis der Daten? Was sind dabei die angestrebten Auswirkungen für die Person? Weitere Informationen finden sich hier: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-automated-individual-decision-making-including-profiling_de#beispiel |
Vorlage Studien- und Datenschutzinformationen
Im Kontext unserer Eye-Tracking-Studie „Consenting Without Being Informed: Testing Approaches to Improve Consent Procedures in Online Surveys“ haben wir aus verschiedenen Strängen eine sehr ausführliche Vorlage für Studien- und Datenschutzinformationen im Rahmen der Einwilligungserklärung zu einer Online-Umfrage zusammengestellt. Da sehr umfangreiche Informationen zu Beginn einer Umfrage oft abschreckend wirken können, empfehlen wir, die Informationen in der Akkordeon-Variante zu präsentieren. Hierbei werden den Teilnehmenden zunächst nur die Überschriften der einzelnen Gliederungspunkte angezeigt. Die Teilnehmenden können dabei selbst entscheiden, ob sie durch einen Klick auf einen Gliederungspunkt mehr Informationen zum jeweiligen Thema sehen möchten (siehe Video unten). Die Akkordeon-Variante ist eine gute Möglichkeit für Online-Umfragen, Informationen in komprimierter Form zu präsentieren und dabei zugleich rechtlichen und forschungsethischen Anforderungen gerecht zu werden.
Die erarbeitete Vorlage wurde im Rahmen unserer Online-Experimente im Herbst 2022 aktualisiert und in Zusammenarbeit mit einem für den Datenschutz zuständigen Mitarbeiter der TU Dortmund an die neusten datenschutzrechtlichen Anforderungen angepasst. Die Vorlage ist ein Beispiel für die Studien- und Datenschutzinformationen und wurden unter der Besonderheit des § 4 DSG NRW erstellt.
Sie soll den Umgang und die Erstellung erleichtern und hierzu als Orientierung dienen. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten unterschiedlich ist und sich die Angaben hierdurch verändern können. Diese Veränderung kann sich z.B. durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen, Verarbeitungszwecken oder eine Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung ergeben.
Die Vorlage steht hier zu Download bereit.
Die Umsetzung der Studien- und Datenschutzinformationen als Akkordeon bietet zum Beispiel die Online-Befragungstool Unipark oder SoSci Survey an. Eine Anleitung zur Umsetzung in SoSci Survey gibt es hier.
Umsetzung Checkliste Datenschutz in Vorlage
Einige der Fragen aus der Checkliste zur Datenschutzerklärung wurden auch in der Vorlage berücksichtigt. Aufgrund der Individualität dieser Umfrage finden sich jedoch nicht alle Punkte (Frage 12 bis 14) in der Vorlage wieder. Hier ein Überblick:
|
Fragen aus Checkliste |
Umsetzung in Vorlage |
|
Frage 1 |
Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich? |
|
Frage 2 |
Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich? |
|
Frage 3 |
Zu welchem Zweck werden meine Daten verarbeitet? |
|
Frage 4 |
Auf welcher Rechtsgrundlage werden meine Daten verarbeitet? |
|
Frage 5 |
Werden personenbezogene Daten über mich erhoben? |
|
Frage 6 |
Trifft hier nicht zu. |
|
Frage 7 |
Werden meine Daten weitergegeben? |
|
Frage 8 |
Werden meine Daten weitergegeben? |
|
Frage 9 |
Trifft hier nicht zu. |
|
Frage 10 |
Wie lange werden meine Daten gespeichert? |
|
Frage 11 |
Welche Rechte habe ich? |
|
Frage 12 |
Trifft hier nicht zu. |
|
Frage 13 |
Trifft hier nicht zu. |
|
Frage 14 |
Trifft hier nicht zu. |
Hilfestellung zur forschungsethischen Selbstreflexion: Eine praxisorientierte „Checkliste“
Ein Forschungsprozess enthält eine Vielzahl an Zwischenschritten, in denen Entscheidungen getroffen, Möglichkeiten abgewogen und Herausforderungen gelöst werden müssen – auch aus forschungsethischer Perspektive. Vor diesem Hintergrund wurde im FeKoM-Projekt eine praxisorientierten „Checkliste“ als Hilfestellung zur forschungsethischen Selbstreflexion erstellt. In ihr werden Fragen zu forschungsethischen Herausforderungen, Lösungsansätze und Diskussionspunkte dargestellt, die im Laufe eines Forschungsprozesses relevant werden können. Basis dafür waren der Austausch mit Workshopteilnehmer*innen, Ergebnisse aus Leitfadeninterviews innerhalb des FeKoM-Projekts und verschiedene Fachliteratur.
Das Dokument steht hier zum Download bereit.
Diese „Checkliste“ ist als Arbeitsdokument einer Systematisierung für die quantitative Forschung zu verstehen, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge an fekom-projekt@tu-dortmund.de sind willkommen.
Lehre und Vermittlung
Zu den Zielen des FeKoM-Projektes gehörte es auch, verschiedene Lehrmaterialien zum Thema Forschungsethik zu entwickeln. Die dazugehörigen Unterlagen werden hier zur Verfügung gestellt.
Lehrvideo
Auf Basis eigener Lehrmaterialien und aufbauend auf den Ergebnissen der verschiedenen Teilstudien haben wir das Lehrvideo „Forschungsethik und Methodik in der angewandten Kommunikations- und Medienforschung“ erstellt. Darin werden unter anderem Definitionen, Anspruchsgruppen, Rahmenbedingungen, Entscheidungsprinzipien, Herausforderungen im Forschungsprozess und Beispiele für spezifische Fragestellungen in den einzelnen Erhebungsmethoden thematisiert. Das Video ist für Studierende als Selbstlerneinheit konzipiert; als solches können es aber auch Lehrende als Ergänzung des eigenen Lehrmaterials (z. B. zur Vorbereitung einer Seminarsitzung) einsetzen. Das Video ist in verschiedene Sinnabschnitte unterteilt, die auch einzeln ausgewählt werden können. Zudem ist es möglich, die Untertitel an- und auszuschalten.
Handouts
Im FeKoM-Projekt haben wir zwei Handouts zum Thema Forschungsethik erstellt, die wir in verschiedenen Workshops und in eigenen Lehrveranstaltungen bereits ausprobiert haben.
Handout Schaden-Nutzen-Abwägung
Auf dem Handout finden sich drei Fallbeispiele mit forschungsethisch herausfordernden Situationen. Die fiktiven Szenarien können z. B. in Gruppenarbeit von Studierenden bearbeitet werden, indem sie eine Schaden-Nutzen-Abwägung durchführen sollen. Als Hilfestellung werden diese Fragen an die Hand gegeben: Welche Belastungen für die Beteiligten haltet ihr für zulässig bzw. unzulässig? Was rechtfertigt den Nutzen bzw. rechtfertigt ihn nicht? Welche forschungsethischen Herausforderungen seht ihr hinsichtlich der methodischen Umsetzung des Vorhabens? Das Handout kann hier heruntergeladen werden.
Handout Heuristik zur Entscheidungsfindung
Auf diesem Handout ist eine Heuristik zur Entscheidungsfindung für die informierte Einwilligung abgebildet. Das Vorgehen ermöglicht es, verschiedene Aspekte eines geplanten Forschungsprojektes auf Kontinuen zu verorten, um daraus abzuleiten, ob eine informierte Einwilligung der Studienteilnehmer*innen eingeholt werden sollte. Um das Handout in der Lehre einzusetzen, kann den Studierenden ein Beispielfall vorgegeben werden, anhand dessen sie die Heuristik ausfüllen. Am Ende wird aus allen eigetragenen Punkten ein gedanklicher Mittelwert gebildet, um herauszufinden, ob in diesem Fall eine informierte Einwilligung nötig ist. Als Beispielfall empfehlen wir die Untersuchung von Äußerungen einer Online-Community (für nähere Informationen siehe Schlütz & Zillich, 2023, S. 10-13). Das Handout kann hier heruntergeladen werden.
Literaturhinweis: Schlütz, D., & Zillich, A. F. (2023). Forschungsethik und wissenschaftliche Integrität: Herausforderungen und Chancen für Forschung in und mit digitalen Medien. In S. Stollfuß, L. Niebling, & F. Raczkowski (Hrsg.). Handbuch Digitale Medien und Methoden. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36629-2_8-1